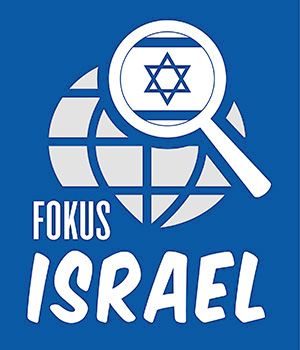20. Oktober 2025
Washington Institute for Near East Policy – Einschätzungen zum Gaza-Abkommen
Fünf Experten und ehemalige hochrangige Offizielle diskutierten am 10. Oktober 2025 das «Gaza First Phase Agreement» – das erste, von der Trump-Administration vermittelte Waffenruhe- und Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas nach über zwei Jahren Krieg. Das Washington Institute gilt als einer der einflussreichsten US-Thinktanks zur Nahostpolitik.
Michael Herzog, ehemaliger israelischer Botschafter in den USA und IDF-Brigadegeneral:
Warum das Abkommen diesmal gelang
- Reife der Lage und US-Führung
Das Abkommen wurde möglich, weil beide Seiten kriegsmüde waren und die Trump-Administration den Moment nutzte, um mit einer kalkulierten Mischung aus Druck und Anreizen beide Parteien an den Verhandlungstisch zu zwingen. - Fokus auf Realisierbares
Der Plan konzentrierte sich zunächst auf Phase 1 – Waffenruhe, Geiselfreilassung, Gefangenenaustausch und Truppenrückzug – während heikle Fragen wie Entwaffnung und Hamas-Entmachtung bewusst vertagt wurden. Dadurch entstand überhaupt erst Verhandlungsspielraum. - Schwäche der Hamas als Hebel
Hamas war durch israelischen militärischen Druck und die Drohung einer weiteren Offensive stark geschwächt. Gleichzeitig übte die USA über eine geschlossene arabisch-muslimische Front (Katar, Türkei) massiven politischen Druck aus. - Israels innenpolitische Logik
Nach zwei Jahren Krieg musste Israel erkennen, dass die Ziele „Hamas besiegen“ und „Geiseln befreien“ nicht gleichzeitig erreichbar sind. Das Abkommen erlaubt, zuerst die Geiseln zu retten, ohne den Sicherheitsanspruch aufzugeben – IDF-Kontrolle über den Grossteil Gazas bleibt bestehen. - Risiken und Ausblick
Der Erfolg hängt von einer aktiven, dauerhaften US-Rolle ab. Die Beteiligung Katars und der Türkei birgt Risiken wegen ihrer Hamas-Nähe; deshalb braucht es Gegengewichte durch pro-westliche arabische Akteure wie die Vereinigten Arabischen Emirate.
Fazit
Der Deal war nur möglich, weil Washington pragmatisch auf Schritt-für-Schritt-Lösungen setzte, Israels Kriegsziele neu priorisierte und regionale Machtzentren taktisch einband. Doch sein Fortbestand hängt davon ab, ob die USA die fragile Balance zwischen Druck, Absicherung und regionalem Einfluss halten können.
Ghaith al-Omari, früherer Berater des palästinensischen Verhandlungsteams:
Schwächen der Palästinensischen Autonomiebehörde und Machtvakuum nach dem Krieg
- Fehlende Rolle der PA
Das Fernbleiben der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) bei den Verhandlungen ist Ausdruck ihrer institutionellen Schwäche und politischen Irrelevanz – nicht Ursache, sondern Symptom eines verkrusteten Systems. - Forderung nach Führungswechsel
Eine Erneuerung der PA erfordert den Abtritt Mahmoud Abbas’ und eine Reform ihrer Strukturen, um Legitimität, Handlungsfähigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen. - Risiko Hamas-Legitimation
Ohne rasche PA-Reform droht Hamas, sich als alleiniger Gesprächspartner der internationalen Gemeinschaft zu etablieren – mit langfristigen Folgen für die palästinensische Staatlichkeit. - Regionale Architektur
Ägypten plant eine innerpalästinensische Dialogplattform, doch die Einbindung der Hamas zeigt, dass sie weiter den Diskurs prägt. Zur Stabilisierung braucht es Saudi-Arabien und die VAE als Gegengewicht zu Türkei und Katar, die Hamas begünstigen. - US-Rolle
Washington muss Druck auf Riad und Abu Dhabi ausüben, um sie in die Nachkriegsordnung einzubinden – sonst bleibt das Machtvakuum bestehen.
Fazit
Ohne tiefgreifende Reform der PA und regionale Balance durch saudisch-emiratische Beteiligung droht der Friedensprozess, Hamas’ politische Legitimität ungewollt zu festigen.
David Makovsky, Ex-Berater des US-Aussenministeriums:
Innenpolitische Dynamik in Israel und Trumps Einfluss
- Öffentliche Stimmung als Hebel
Der Deal wurde durch breite israelische Zustimmung zu einem Kriegsende und zur Freilassung der Geiseln politisch möglich. - Netanyahus Narrative
Premier Netanyahu wird den Erfolg innenpolitisch als Ergebnis israelischer Stärke und US-Partnerschaft darstellen – nicht als amerikanischen Druck. - Oppositioneller Gegenentwurf
Seine Gegner betonen dagegen, Trump habe die Einigung erzwungen, und Netanyahu habe durch seine Zögerlichkeit unnötig Opfer und Reputationsschäden verursacht. - Vorwahlkalkül
Ein früher Wahltermin würde Netanyahu paradoxerweise Handlungsfreiheit geben, da die Koalition weniger als Druckmittel wirkt. - Offene Fragen
Unklar bleibt, ob internationale Kräfte an Hamas’ Entwaffnung beteiligt werden und wie weit Israel sich militärisch zurückzieht – Jerusalem will sich militärische Operationsfreiheit vorbehalten.
Fazit
Trumps Diplomatie verschiebt Israels innenpolitische Achse: Der Deal wird zur Bühne für Wahlkampf-Narrative, während die praktische Umsetzung sicherheitspolitisch offen bleibt.
Neomi Neumann frühere Leiterin der Forschungsabteilung des israelischen Inlandsgeheimdienstes:
Hamas’ Taktik, Erfolge und politische Aufwertung
- Taktische Anpassung statt Kurswechsel
Hamas zeigt Flexibilität aus Zwang, nicht aus Mässigung – sie pausiert den Kampf, um sich militärisch zu regenerieren und politisch zu stärken. - Ursachen der Verhandlungsbereitschaft
Druck durch Israels Offensive, Angst vor innerpalästinensischer Kritik und massiver US-/arabischer Druck (v. a. Türkei, Katar) zwangen Hamas an den Tisch. - Strategische Gewinne
Hamas erreichte drei Ziele:
1. Verhinderung der israelisch-saudischen Normalisierung,
2. internationale Sichtbarkeit der palästinensischen Sache,
3. Freilassung ranghoher Gefangener, die ihre politische Basis stärken.
- Symbolische Aufwertung
Als einzige palästinensische Vertretung in den Gesprächen erhielt Hamas politische Legitimität und festigte ihren Anspruch auf Führungsrolle. - Schwäche der PA als Katalysator
Das Fehlen Mahmoud Abbas’ verstärkte den Eindruck, Hamas sei die einzige handlungsfähige Kraft der Palästinenser.
Fazit:
Hamas verlor militärisch, gewann aber symbolisch: Der Waffenstillstand verschiebt die politische Legitimität im palästinensischen Lager klar zu ihren Gunsten.
Nickolay Mladenov, Ex-UNO-Sondergesandter und heutiger Leiter der Anwar Gargash Diplomatic Academy (VAE):
Internationale Sicherung und Governance der Nachkriegsordnung
- US-Führung als Erfolgsschlüssel
Trumps 20-Punkte-Plan nutzte entschlossenen diplomatischen Druck und breite arabisch-muslimische Koalition, um die Waffenruhe zu erzwingen. - Humanitäre und institutionelle Säulen
Der Plan schafft sowohl sofortige humanitäre Entlastung als auch den Rahmen für neue Governance-Strukturen in Gaza – mit regionaler Einbettung. - Unvollständige Umsetzung
Hamas ignorierte zentrale israelische Forderungen nach Entmilitarisierung und Deradikalisierung – ein Hinweis auf die Fragilität des Friedens. - Notwendigkeit externer Stabilisierung
Dauerhafte US-Präsenz, plus europäische und regionale Beteiligung (finanziell und militärisch), sind entscheidend, um Rückfälle zu verhindern. - Empfohlener Mechanismus
Eine UN-Sicherheitsratsresolution sollte eine multinationale Eingreiftruppe mit robustem Mandat schaffen – mehr als klassische Blauhelme –, um Sicherheit und Governance zu gewährleisten.
Fazit
Ohne glaubwürdige internationale Sicherheitsarchitektur droht die Waffenruhe zu zerfallen – Stabilität hängt von anhaltender US-Führung und multinationaler Durchsetzungskraft ab.Quelle: Washington Institute for Near East Policy
Haben Sie einen Fehler entdeckt?