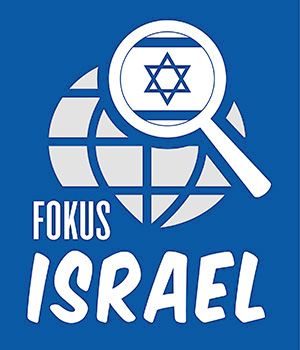30. Oktober 2025
Von Heinrich Rothmund zu Beat Jans
Von Sacha Wigdorovits

Heute, am 30. Oktober 2025, wäre mein Vater 100-jährig geworden. Mein Vater war 1947 als junger Student aus Ungarn in die Schweiz gekommen, um sich seinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen: An der weltberühmten ETH in Zürich sein Studium als Elektroingenieur abzuschliessen – was er dann auch tat.
Mit der Schweiz verband meinen Vater schon vorher viel. Denn es war ein vom Schweizer Vizekonsul in Budapest, Carl Lutz, ausgestellter Schutzbrief gewesen, der ihm als Juden im von den Deutschen besetzten Ungarn das Leben gerettet hatte. Bis er schliesslich doch gezwungen war, sich vor den «Pfeilkreuzlern», den ungarischen Nazis, im Untergrund in Sicherheit zu bringen.
Am Tag nach seiner Ankunft im Hauptbahnhof Zürich begann sich das Leben meines Vaters zum Guten zu wenden: In Wettingen lernte er Branka Frank kennen, eine junge Jüdin aus Jugoslawien – meine Mutter.
Sie war mit ihrer Mutter, ihren beiden Schwestern und weiteren engen Familienangehörigen im August 1943 in die Schweiz gekommen. Als illegale Flüchtlinge gelangten sie von Italien aus ins bündnerische Castasegna. Gerettet hatten sie drei Schweizer Soldaten, die sie mit den Rufen «Svizzera, Svizzera» aus dem Niemandsland bei der italienischen Grenze in die Schweiz in Sicherheit lotsten.
Ein vierter Soldat, ein junger Zürcher Rechtsanwalt namens Veith Wyler, bewahrte sie am folgenden Tag davor, wieder ins damals schon von den Deutschen besetzte Italien und damit in den sicheren Tod abgeschoben zu werden.
Diese vier Schweizer Soldaten handelten gegen den ausdrücklichen Befehl des Bundesrates. So wie Carl Lutz, der mit seiner später auch von Schweden übernommenen Schutzbrief-Politik über 60’000 ungarischen Jüdinnen und Juden das Leben rettete, gegen die offizielle Schweizer Politik gehandelt hatte.
Dasselbe tat in St. Gallen der dortige Polizeikommandant Paul Grüninger, der sich ebenfalls dieser unmenschlichen Politik widersetzte und Tausende von illegal in die Schweiz eingereiste jüdische Flüchtlinge vor dem Tod bewahrte. Und ebenso handelte die Bevölkerung von Diepoldsau gegen den Befehl des Bundesrates, als sie 1942 den Grenzübergang zu Deutschland blockierte, damit die Polizei 20 jüdische Flüchtlinge nicht dorthin zurück deportieren konnte.
Alle diese Schweizer Bürgerinnen und Bürger widersetzten sich aus Gründen ihres christlichen Gewissens und der Menschlichkeit der judenfeindlichen und nazifreundlichen Politik des Bundesrates. Denn dieser hatte auf Initiative des damaligen Chefs der Fremdenpolizei, Heinrich Rothmund, 1938 beschlossen, keine jüdischen Flüchtlinge mehr aufzunehmen.
Später verteidigte der damalige Bundesrat Eduard von Steiger diese nazifreundliche Politik mit den berühmt-berüchtigten Worten: «Das Boot ist voll.»
Aber die offizielle Begründung von Bundesrat und Fremdenpolizei lautete damals, dass Menschen, die aus «rassischen» und nicht «politischen» Gründen verfolgt wurden, nicht als Flüchtlinge zu anerkennen seien. Damit dieser Beschluss leichter umzusetzen war, bat die Schweiz die deutsche Regierung, die Pässe von deutschen Juden mit dem sogenannten «Judenstempel» zu versehen.
Neben der juristischen Begründung, die Juden seien als «rassisch Verfolgte» gar keine richtigen Flüchtlinge, rechtfertigte der Bundesrat seine Politik auch mit dem zynischen Argument, dass sich durch die Aufnahme von zu viel Juden der Antisemitismus in der Schweiz ausbreiten würde.
Wie sich heute zeigt, hat diese Politik nicht funktioniert. Denn obschon in der Schweiz gerade einmal 18’000 Juden leben – das entspricht rund 0.2 Prozent der Bevölkerung –, sehen wir uns heute mit einem in unserem Land nie dagewesenen Antisemitismus konfrontiert.
Auf den Strassen und in den Universitäten äussert er sich durch Rufe nach der Vernichtung von Israel, die als Forderung «from the river to the sea» kaschiert wird. Und durch das Gebrüll «Tod den Juden», die heute als «Zionisten» bezeichnet werden, um sie nicht Juden nennen zu müssen.
Aber dieser Antisemitismus wird auch erneut von vielen Politikern mitgetragen und gefördert. Allerdings mit einem wesentlichen Unterschied zu den 1930-er und 1940-er Jahren. Damals waren es die deutschfreundlichen, nationalkonservativen Kreise, welche die antisemitische Haltung der Schweiz prägten. Heute hingegen sind es die Sozialdemokraten und Grünen.
Selbstverständlich weisen diese Parteien den Vorwurf entschieden zurück, antisemitisch zu sein. Denn ihre Politik richte sich ja nicht gegen die Juden im Allgemeinen, sondern «nur» gegen Israel, sagen sie.
Das ist verbale Haarspalterei. Denn wer dem einzigen jüdischen Staat der Welt das Recht auf Selbstverteidigung gegen palästinensische Terroristen abspricht, der spricht den Juden das Recht auf Existenz ab. Egal, wo.
Übernommen haben die palästinenserfreundlichen linken Politiker die Verlogenheit ihrer nazifreundlichen bürgerlichen Vorgänger. Hatten diese damals ihre judenfeindliche Flüchtlingspolitik damit begründet, sie wollten die Schweizer Juden vor Antisemitismus bewahren, so behauptet heute SP-Bundesrat Beat Jans, er nehme verletzte Kinder und ihre Familien aus dem kriegsgeplagten Gaza aus Gründen der Menschlichkeit auf.
Wenn es Jans tatsächlich um humanitäre Hilfe ginge, dann hätte er dafür gesorgt, dass die Millionen von Franken, welche dies Aktion verschlingt, vor Ort und in den benachbarten Ländern für die medizinische Versorgung eingesetzt würden, wo sie viel wirksamer wären. Nebenbei: Kinder und Erwachsene aus Gaza wurden und werden schon immer auch in israelischen Spitälern behandelt. In der Regel kostenlos.
Aber Jans geht es gar nicht um Hilfe. Er will mit seiner «beschämenden PR-Aktion» (Filippo Leutenegger, FDP-Kantonalpräsident Zürich) ein Protestzeichen gegen Israel setzen, dem von seiner Partei, der SP, völlig zu Unrecht ein «Genozid» an den Palästinensern vorgeworfen wird.
Damit geht Jans sogar noch einen Schritt weiter als seine Vorvorgänger Eduard von Steiger und Giuseppe Motta und als Fremdenpolizeichef Heinrich Rothmund. Diese hatten damals lediglich verhindert, dass die Schweiz verfolgte Juden aufnahm. Jans hingegen nimmt mit den palästinensischen Erwachsenen, welche die Kinder aus Gaza begleiten, Mitglieder einer Bevölkerungsgruppe auf, deren erklärtes Ziel die Vernichtung von Juden ist. Und er tut dies wissentlich.
Ich vermisse meine Eltern sehr. Aber ich bin froh, dass sie, die später dankbare und stolze Schweizer wurden, dies nicht mehr miterleben müssen.
Dieser Beitrag erschien auch auf Nebelspalter.ch
Sacha Wigdorovits ist Präsident des Vereins Fokus Israel und Nahost, der die Webseite fokusisrael.ch betreibt. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte, Germanistik und Sozialpsychologie und arbeitete unter anderem als USA-Korrespondent für die SonntagsZeitung, war Chefredaktor des BLICK und Mitbegründer der Pendlerzeitung 20minuten.
Haben Sie einen Fehler entdeckt?