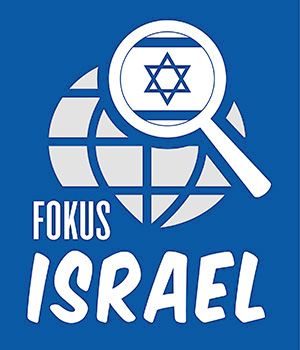1. Juli 2025
NZZ: Die unsichtbare Bombe – warum Israel eine Politik der nuklearen Zweideutigkeit verfolgt
«Jeder weiss, dass Israel über Atomwaffen verfügt, doch Jerusalem pflegt eine Politik der Ambiguität. Mit gutem Grund», schreibt NZZ-Gastautor Richard C. Schneider.
Israel besitzt Atomwaffen – und tut so, als ob es sie nicht hätte. Diese strategische Ambiguität ist seit Jahrzehnten Teil israelischer Staatsraison und hat einen doppelten Zweck: Abschreckung gegen existenzielle Bedrohungen, ohne ein Wettrüsten im Nahen Osten offen zu provozieren.
Der Ursprung liegt in den 1950er-Jahren. Damals, nach dem Unabhängigkeitskrieg und dem Suezkrieg, wurde das junge Israel sich seiner Verwundbarkeit schmerzlich bewusst. Shimon Peres, damals Generaldirektor im Verteidigungsministerium, handelte mit Frankreich ein geheimes Atomabkommen aus, das 1957 zur Errichtung des Reaktors im Negev führte. Das heute als Dimona bekannte Forschungszentrum wurde zur Keimzelle der israelischen Nuklearstrategie.
Bis Ende der 1960er-Jahre verfügte Israel laut Experten über genügend Plutonium für erste Sprengköpfe – ein entscheidender Vorsprung. Die USA wussten Bescheid, aber Präsident Richard Nixon einigte sich mit Israel auf eine still-schweigende Übereinkunft: keine Tests, kein Bekenntnis – im Gegenzug keine Einmischung. Henry Kissinger schrieb dazu intern, eine Offenlegung wäre ein «Worst-Case-Szenario».
Trotzdem wurde Israels Ambiguität 1986 durch Mordechai Vanunu erschüttert. Der Techniker enthüllte der Sunday Times, Israel verfüge über Material für bis zu 150 Sprengköpfe. Der Mossad entführte ihn daraufhin in Rom. Er wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt.
Es blieb nicht die einzige Panne: 2008 liess sich Ehud Olmert in einem Interview mit SAT.1 zu dem Satz hinreissen, Israel besitze Atomwaffen – ein Versprecher, der international Wellen schlug. Auch Benjamin Netanyahu sprach in Reden von «aussergewöhnlichen Fähigkeiten» – ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Teheran.
Israel verfolgt keine Zweideutigkeit um ihrer selbst willen. Mit der Lieferung von Dolphin-U-Booten aus Deutschland, die als Trägersysteme für nukleare Marschflugkörper gelten, wurde eine Second-Strike-Fähigkeit etabliert – also die Fähigkeit zum Gegenschlag nach einem atomaren Erstschlag. Ein Mechanismus, der in der Logik nuklearer Abschreckung überlebenswichtig ist – nicht nur militärisch, sondern symbolisch: «Nie wieder Holocaust.»
Offiziell bleibt Israel jedoch ausserhalb des Atomwaffensperrvertrags (NPT). Es gibt keine Inspektionen durch die IAEA, keine Verpflichtung zur Abrüstung – eine völkerrechtliche Grauzone, die bislang vom Veto der USA gedeckt wird.
Der sogenannte Vela-Zwischenfall 1979 – ein möglicher geheimer Test im Südatlantik – bleibt bis heute ungeklärt. Ebenso spekulativ bleibt die Schätzung westlicher Geheimdienste: Israel verfüge inzwischen über bis zu 400 einsatzfähige Sprengköpfe, transportierbar per Rakete (Jericho II/III), U-Boot oder Flugzeug.
Diese nukleare Macht wirkt paradoxerweise stabilisierend – und zugleich destabilisierend: „Teheran verweist regelmässig auf Israels Arsenal als Beleg für nukleare Ungleichbehandlung.“ Auch Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei denken öffentlich über eigene Programme nach.
Ob Israels Schweigen künftig weiter als Schutzschild funktioniert oder zur Bürde wird, hängt vom geopolitischen Klima ab. Nach dem Ende des Iran-Kriegs, so Schneider, könnte diese Diskussion nun näher rücken – und die unsichtbare Bombe sichtbarer werden.
Vollständiger Beitrag (Bezahlschranke)
Haben Sie einen Fehler entdeckt?