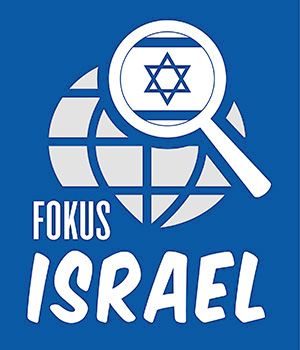24. Oktober 2025
Give Peace a Chance
von Sacha Wigdorovits
Vor rund vier Wochen hat US-Präsident Donald Trump seinen 20-Punkte-Friedensplan für Gaza vorstellt. Knappe zwei Wochen später gaben Israel und die Terrororganisation Hamas schriftlich ihre Zustimmung zur Umsetzung von dessen erster Phase bekannt.
Daraufhin zog Israel sich in Gaza auf eine vereinbarte Position zurück und liess 2’000 gefangene Palästinenser frei, darunter 250 verurteilte Terroristen. Hamas ihrerseits gab sämtliche noch lebenden 20 Geiseln des Massakers vom 7. Oktober 2023 frei. Die Leichen von 18 weiteren Geiseln, die in Gaza festgehalten wurden, werden seither schrittweise ebenfalls an Israel übergeben.
So weit, so gut, würde man meinen. Dennoch liest man in den Medien nur eines: Weshalb es mit der restlichen Umsetzung des Friedensplans nicht klappen wird.
Nun stimmt es zwar, dass die weiteren Plan-Etappen zur Beendigung des Konflikts zwischen den Palästinensern und Israel einige Knacknüsse aufweisen. Die grösste ist, Hamas zu entwaffnen und von der Macht in Gaza zu entfernen.
Aber ist dies tatsächlich so unmöglich und unwahrscheinlich, wie es behauptet wird? Immerhin haben neben Saudi-Arabien und Ägypten auch die Türkei und Katar den US-Friedensplan formell unterzeichnet. Damit gaben die beiden grössten Unterstützer der Hamas ihr Einverständnis zu deren Entwaffnung.
Hinzu kommt, dass die Bevölkerung von Gaza den Frieden herbeisehnt. Dieser ist aber nur mit der Umsetzung des Trump-Plans dauerhaft zu haben.
Auch militärisch gesehen, steht die Terrorgruppe nach zwei Jahren Krieg mit dem Rücken zur Wand. Zumal US-Präsident Trump unmissverständlich erklärt hat, falls Hamas ihrer Entwaffnung nicht «freiwillig» zustimme, dann werde ihr diese aufgezwungen.
Das bedeutet, Israel hätte die volle Rückendeckung der US-Regierung, wenn es militärisch wieder losschlägt, falls Hamas sich den restlichen Punkten des Friedensplans – und somit auch ihrer Entwaffnung – widersetzen sollte.
Der externe und interne Druck auf Hamas ist also gross. Umso unverständlicher ist das Paradox, dass ihre einzigen Alliierten in Israel sitzen: die rechtsaussen angesiedelten Nationalreligiösen und Ultranationalisten. Denn diese beiden politischen Gruppierungen versuchen ebenso wie die palästinensische Terrororganisation mit allen Mitteln, die weitere Umsetzung des Gaza-Friedensplans zu verhindern.
Die vor wenigen Tagen aus diesen Kreisen lancierte Gesetzesvorlage zur Annexion des Westjordanlandes zielt genau darauf ab. Das Gesetz wurde im israelischen Parlament, der Knesset, in erster Lesung mit 25:24 Stimmen angenommen.
Es wurde also von weniger als einem Viertel aller Abgeordneten gutgeheissen. Dabei stimmten die Ratsmitte und die linken Parteien dagegen und die Vertreter der Likud, der Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, enthielten sich mit einer Ausnahme der Stimme. Netanyahu selbst hatte zuvor erfolglos versucht, die Abstimmung zu verhindern.
Es ist somit klar, dass das Annexionsgesetz am Schluss nie durchkommen wird. Aber die Ultrareligiösen und Rechtsradikalen schaden mit ihrem konfrontativen Verhalten dennoch dem eigenen Land. Denn sie setzen damit das gute Verhältnis Israels zu seinem engsten Verbündeten aufs Spiel, den USA.
So bezeichnete der amerikanische Vizepräsident JD Vance den Entscheid der Knesset erbost als «Dummheit». Und sein Chef, Präsident Trump, erklärte klipp und klar: Falls Israel das Westjordanland annektiert, dann wird es jegliche Unterstützung durch die USA verlieren.
Um den US-Friedensplan gegen diesen Widerstand von Hamas einerseits und von Israels Rechtsradikalen andererseits umzusetzen, sind deshalb drei Dinge entscheidend:
- Den schönen Worten müssen seitens der Türkei und der arabischen Staaten sowie seitens von Frankreich, Italien und Deutschland jetzt Taten folgen.
Das heisst: Diese Länder müssen sich, wie sie es versprochen haben, mit Soldaten an der im Friedensplan vorgesehenen Sicherheitstruppe in Gaza beteiligen. Und als allererstes muss diese Sicherheitstruppe dann dafür sorgen, dass Hamas entwaffnet und Gaza demilitarisiert wird. - Israel braucht eine neue Koalitionsregierung, in der die Ultranationalisten und Nationalreligiösen nicht mehr vertreten sind. Ob diese Regierung auch auf die Unterstützung von Ministerpräsident Netanyahus Likud wird verzichten können, ist selbst im Falle von Neuwahlen fraglich.
«Dealmaker» Donald Trump hat deshalb bereits vor einigen Monaten und auch kürzlich wieder, in seiner Ansprache in der Knesset, einen Weg aufgezeigt, wie die beiden zerstrittenen Lager sich auf eine Zusammenarbeit einigen könnten: Mitte-Links stimmt der Einstellung des Korruptionsverfahrens gegen Netanyahu zu. Dieser verpflichtet sich im Gegenzug, nicht mehr für eine (volle) weitere Amtszeit zu kandidieren.
Rechtsstaatlich wäre ein solcher «Deal» zwar unschön, aber er wäre im Interesse des Landes. Dies muss insbesondere in der gegenwärtigen Situation Vorrang haben. - Die USA müssen ihren massiven Druck auf beide Seiten aufrechthalten. Das heisst: auf die arabischen Staaten und Türkei einerseits und auf Israel andererseits. Getreu dem Motto von Goethes Erlkönig: «Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.»
Dass die grösste Wirtschafts- und Militärmacht der Welt über die nötigen Mittel dazu verfügt und willens ist, diese einzusetzen hat sie in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt.
Ist also die weitere Umsetzung des Trump-Friedensplans eine «gemachte Sache»? Nein, das ist sie nicht! Aber sie ist auch nicht so unmöglich, wie sie oft dargestellt wird.
Vor allem aber ist sie eines: alternativlos. Denn keiner jener Apologeten, welche das 20-Punkte-Konzept für den Frieden in Gaza – und damit für den Frieden zwischen den Palästinensern und Israel – als unrealistisch bezeichnen, hat bisher eine bessere und realistischere Lösung vorgeschlagen.
Statt in den Schwanengesang auf den Trump-Friedensplan einzustimmen, sollten wir deshalb besser mit John Lennon singen «Give peace a chance».
Haben Sie einen Fehler entdeckt?