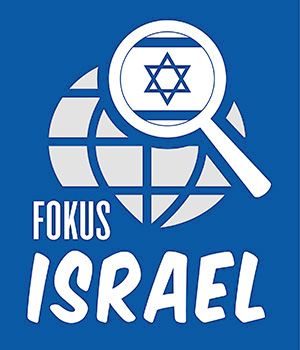10. Oktober 2025
10 Erkenntnisse vom 7. Oktober und der Zeit seither
Von Sacha Wigdorovits
Für Israel geht eine bewegte Woche zu Ende. Am Dienstag jährte sich zum zweiten Mal das Massaker vom 7. Oktober 2023, bei dem über 1’200 israelische Zivilisten, Bürger anderer Staaten sowie Angehörige der israelischen Armee und Polizei von palästinensischen Terroristen ermordet und weitere 251 als Geiseln entführt wurden.
Nur zwei Tage später, am Donnerstag, 9. Oktober, folgte dann die bis vor kurzem für unmöglich gehaltene erlösende Nachricht: Israel und Hamas haben sich über die ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen 20-Punkte-Friedensplans für Gaza geeinigt. Der Krieg wird beendet.
Dies bedeutet, dass alle 48 der noch von Hamas festgehaltenen Geiseln des 7. Oktober in den nächsten Tagen nach Israel zurückkehren werden. 20 von ihnen sollen noch am Leben sein.
Beide Ereignisse – der Jahrestag des grössten Pogroms der Nachkriegsgeschichte und die Nachricht über die bevorstehende Rückkehr der letzten von Hamas entführten Geiseln – waren geprägt von Emotionen.Aber es ist auch an der Zeit darüber nachzudenken, welche Erkenntnisse wir aus den letzten zwei Jahre ziehen können. Zum Beispiel die folgenden:
- Überheblichkeit ist tödlich. Noch ist nicht abschliessend geklärt worden, wie es am 7. Oktober 2023 im Süden Israels zu einem Massaker solchen Ausmasses kommen konnte. Aber schon heute lässt sich sagen, dass die israelische Regierung – und mit ihr auch die Militärführung und die Spitzen der Geheimdienste –versagt hat.
Die Regierung hatte die Sicherheit an der südlichen Grenze zu Gunsten der Siedlungen im Westjordanland vernachlässigt. Dort leben 900’000 Israelis, die zu den treusten Wählern der derzeitigen Rechtsaussen-Regierung gehören. Bezüglich der in Gaza regierenden Hamas wiegte sich die Regierung in eine falsche Sicherheit, weil sie während Jahren erlaubt hatte, dass Katar die Terrororganisation finanzierte.
Dies dürfte mit ein Grund gewesen sein, dass die Regierung in den Tagen vor dem 7. Oktober Warnungen von an der Grenze stationierten Soldaten und aus den Reihen der Geheimdienste über ungewöhnliche Aktivitäten in Gaza in den Wind schlug.
Der Armeespitze und den Geheimdiensten ihrerseits muss vorgeworfen werden, dass sie Hamas für unfähig hielten, eine Operation dieser Grössenordnung generalstabsmässig zu planen und durchzuführen.
Dieses Versagen kostete am 7. Oktober nicht nur 1’200 Menschenleben, sondern auch das Vertrauen in die israelische Armee IDF und insbesondere in die bis dahin hochangesehenen israelischen Geheimdienste.
Später eliminierten diese dann der Reihe nach mit aufsehenerregenden Aktionen die wichtigsten Führer von Hamas, der libanesischen Terrormiliz Hisbollah sowie die Spitzen von Armee, Revolutionsgarden und Atomprogramm im Iran und jene der im Jemen operierenden Terrormiliz Huthi.
Damit rehabilitierten Armee und Geheimdienste zwar weitgehend ihren am 7. Oktober 2023 arg beschädigten Ruf. Aber die 1’200 Opfer der damaligen Fehleinschätzung der Hamas werden dadurch nicht wieder lebendig und das Leid ihrer Angehörigen nicht gemindert. - Kriege dauern länger und sind teurer als angenommen. Letztlich hat Israel an allen Fronten, an denen das Land wegen des Terrorakts vom 7. Oktober kämpfen musste, gesiegt. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Krieg in Gaza viel länger dauerte und viel grössere Opfer forderte, als zunächst angekündigt worden war.
Sollten in den kommenden Monaten auch die weiteren Punkte des Trump-Friedensplans umgesetzt und der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis endgültig beigelegt werden, so waren diese Opfer mindestens nicht umsonst. - Politische Veränderungen im Nahen Osten sind ohne militärische Gewalt nicht zu erreichen. «Im Gegensatz zu Europa wissen wir, dass mit Diplomatie allein die Ziele nicht immer zu erreichen sind.» Das sagte der neue israelische Botschafter in der Schweiz, Tibor Schlosser, kurz nach seinem Amtsantritt im Gespräch mit FokusIsrael.ch.
Die jüngste Entwicklung bestätigt diese Erkenntnis. Nur weil die israelische Regierung die militärische Offensive gegen Hamas fortsetzte und dem internationalen und innerisraelischem Druck nicht nachgab, ist die Terrororganisation jetzt bereit, über einen Friedensplan zu verhandeln, der zu ihrer Entwaffnung und Entmachtung führen wird.
Dieses Einlenken geschieht nicht so sehr aus eigener Überzeugung, als vor allem unter dem Druck aus Katar, der Türkei und anderen muslimischen Ländern. Völlig irrelevant sind hingegen in diesem Prozess – wie im ganzen Konflikt überhaupt – die UNO und jene westlichen Regierungen, die mit einer voreiligen Anerkennung des nicht existierenden Staates Palästina Druck auf Israel ausüben wollten. - Das Völkerrecht muss angepasst werden. In seinem Kampf gegen die Hamas wurde Israel immer wieder bezichtigt, das Völkerrecht zu missachten und sogar einen Genozid an der palästinensischen Bevölkerung zu begehen. Einerseits wegen der Angriffe auf zivile Anlagen, andererseits, weil sie vorübergehend Hilfslieferungen verbot.
Die Genfer Konventionen lassen indessen beides unter gewissen Umständen zu – und zwar genau in jenen Fällen, in denen Israel dies tat. Deshalb sind diese Vorwürfe an die Adresse Israels haltlos.
Gänzlich ungerechtfertigt ist auch der Genozid-Vorwurf, der bei uns aus dem linken politischen Spektrum immer wieder erhoben wurde. Denn noch nie hat eine kriegsführende Macht zum Schutz der feindlichen Zivilbevölkerung so umfassende Massnahmen ergriffen, wie die israelische Armee IDF dies in Gaza tat.
Trotzdem muss das nach dem Zweiten Weltkrieg verfasste Völkerrecht angepasst werden. Dies verdeutlichte der Krieg Israels mit dem Iran.
Die Mullahs in Teheran haben die Vernichtung des jüdischen Staates seit jeher zur Staatsräson erklärt und die Entwicklung einer Atombombe aus diesem Grund vorangetrieben.
Trotz dieser eindeutigen Ankündigung und Vernichtungsgefahr erklärten verschiedene Völkerrechtsexperten, dass Israel seinen Präventivschlag gegen das iranische Atomwaffenprogramm nicht hätte durchführen dürfen. Dies, so die betreffenden Völkerrechtler, wäre erst unmittelbar vor einem iranischen Atomangriff erlaubt gewesen.
Mit anderen Worten: Israel hätte mit dem Angriff warten müssen, bis es die eigene Vernichtung kaum mehr hätte verhindern können.
Ein Recht, das von einem Staat und Volk ein solches selbstzerstörerisches Verhalten fordert, muss dringend angepasst werden. - Die sozialen und traditionellen Medien sind ein Instrument der hybriden Kriegsführung.Der Konflikt in Gaza war auch ein Propagandakrieg. Dabei spielten insbesondere die sozialen Medien eine entscheidende Rolle. Sie stärkten Hamas und schwächten Israel.
Als Beweis für die angebliche Unmenschlichkeit ihres Gegners setzte die Terrororganisation fortlaufend ungeprüfte Informationen in Umlauf. Vor allem unüberprüfbare Opferzahlen und aus dem Kontext gerissene, von eigenen Fotografen gestellte oder mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz gefälschte Bilder. Diese fanden auf Kanälen wie Facebook, Tiktok, Telegram, X und Instagram innerhalb von Minuten millionenfache Verbreitung.
Dieser zynische Appell an das Mitleid und die Empörung des uniformierten Publikums wirkte umso besser, als er auch viele Journalisten «ansteckte». Die Folge war eine Berichterstattung über den Gaza-Konflikt, die von Gefühlen geprägt wurde statt von den üblichen handwerklichen Grundsätzen des Journalismus.
Damit ebneten die sozialen und zahlreiche traditionelle Medien den Boden für die Massen-Protestaktionen gegen den jüdischen Staat in der westlichen Welt.
Israel versuchte zwar, die irreführende Hamas-Propaganda mit Aufklärung und faktenbasierter Information zu kontern. Aber es scheiterte damit. Denn im Kampf zwischen Emotionen und nüchternen Tatsachen gewinnen immer die Emotionen.
Andererseits konnte es sich Israel als demokratischer Rechtsstaat nicht leisten, eine ähnliche lügenbasierte Propaganda zu betreiben wie die palästinensische Terrororganisation. Die westlichen demokratischen Regierungen tun gut daran, daraus ihre Lehren für eigene Konflikte und ihre Verwundbarkeit in den sozialen Medien zu ziehen. - Europa beugt sich dem Druck der Strasse. Kurz nach dem 7. Oktober 2023 gaben sich die europäischen Regierungen bei ihren Solidaritäts-Besuchen in Israel praktisch die Klinke in die Hand.
Davon ist nicht viel übriggeblieben. Je länger der Krieg dauerte, je stärker die Opferzahlen stiegen und die damit zusammenhängende Desinformation durch Hamas, UNO und UNO-nahe NGOs zunahm, umso grösser wurden die Protestmärsche auf den Strassen der europäischen Metropolen. Und umso mehr distanzierten sich die europäischen Regierungen und anderen Institutionen vom jüdischen Staat und drohten ihm mit Sanktionen.
Für Israel selbst ist dies politisch und militärisch weitgehend irrelevant. Aber es dürfte das Land darin bestätigt haben, dass auf Europa kein Verlass ist. - Europa verkennt immer noch die Gefahr des radikalen Islam. Die anti-israelischen und antisemitischen Massenproteste auf den europäischen Strassen wurden meistens von Aktivisten aus dem linken und linksextremen Spektrum organisiert.
Aber ihren militanten und antisemitischen Charakter verdankten diese Kundgebungen in erster Linie radikalen Islamisten, die in den vergangenen Jahrzehnten mit Unterstützung von Muslimbruderschaft und Geld vom katarischen Staat in Europa Fuss gefasst haben. Dies vor allem in Frankreich, Grossbritannien und Deutschland, aber auch in der Schweiz.
Seit dem 7. Oktober leben diese religiösen Fanatiker nicht nur ihr Gewaltpotenzial gegen die Juden (und Polizei) offen aus, sondern sie machen auch kein Hehl mehr aus ihrer fundamentalistischen islamistischen Agenda.
Dennoch wird ihre mittel- und langfristige Bedrohung für unsere westlich-demokratische Gesellschaft von den etablierten Parteien und Regierungen in Europa nicht ernst genommen. Im Gegenteil: Wer davor warnt, wird als «islamophob» abgestempelt.
Dies ist unverzeihlich. Denn die Aushöhlung unserer Demokratie, welche diese islamistischen Fanatiker nahezu ungehindert betreiben dürfen, ist nicht bloss gegen die Juden und anderen Minderheiten gerichtet. Sie betrifft uns alle – in ganz besonderem Masse die Frauen, die in den Augen der Islamisten Menschen zweiter Klasse sind. - Gewaltbereiter Antisemitismus ist im Westen tief verankert. Die Islamisten, die seit zwei Jahren auf unseren Strassen marschieren, haben mit ihrem Protest gegen die «Zionisten» – sprich: gegen die Juden – in unserer Gesellschaft offene Türen eingerannt.
Dies illustrieren die vermehrten tätlichen Angriffe auf Juden und jüdische Einrichtungen. Es zeigt sich an den Universitäten, wo linksextreme Studierende begeistert antisemitische Parolen brüllen, jüdische Kommilitonen drangsalieren und ausgrenzen. Und es wird in den sozialen Medien und sogar im eigenen privaten Umfeld sichtbar.
Insofern hat der 7. Oktober sein Gutes: Er hat klargemacht, dass der Antisemitismus in unserer Gesellschaft nicht ausgestorben ist und es nur wenig braucht, damit er wieder offen und gewaltsam ausgelebt wird. - Israel kann nur sich selbst vertrauen. Das Verhalten der Staatengemeinschaft in den letzten zwei Jahren hat verdeutlicht, dass Israel nur sich selbst vertrauen kann. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Europa. Aber die eigene Unabhängigkeit weiter zu stärken, ist aus israelischer Sicht auch bezüglich der USA ein strategischer Imperativ.
Zwar ist der jetzige Friedensplan, der auch den Sorgen und Ängsten Israels Rechnung trägt, der US-Regierung zu verdanken. Aber nur weil der amerikanische Präsident Donald Trump heisst. Sässe an seiner Stelle die Demokratin Kamala Harris im Weissen Haus, dann würde jetzt kein 20-Punkte-Friedensplan auf dem Tisch liegen, der für den jüdischen Staat annehmbar ist. - Israel steht am Scheideweg. Der Konflikt mit Hamas hat indessen nicht nur die Verletzlichkeit des jüdischen Staates gegenüber Terror, hybrider Kriegsführung, opportunistischen westlichen Regierungen und dem Ausgang von Wahlen in den USA gezeigt.
Die letzten zwei Jahre haben auch die innere Zerrissenheit Israels verstärkt. Der tiefe Graben zieht sich in zweifacher Hinsicht mitten durch die israelische Gesellschaft.
Einerseits entzweit er die politisch gemässigten Teile der Bevölkerung von den rechten bis extrem-rechten Israelis, die von einem «Grossisrael» unter Einschluss des Westjordanlands und Gazas träumen. Ein Traum, der mit dem Gaza-Friedensplan von Präsident Trump unvereinbar ist und dem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dieser Tage in Washington eine klare Absage erteilt hat.
Andererseits stehen sich die säkularen Teile der Gesellschaft und die ultraorthodoxen Juden gegenüber. Wie fundamental dieser Gegensatz ist, zeigt sich an der Debatte um die allgemeine Wehrpflicht. Diese gilt gemäss Entscheid des Obersten Gerichtshofes auch für Ultraorthodoxe. Doch die meisten von ihnen – nicht alle! – weigern sich, dem Aufruf in die Armee zu folgen.
Diese Verweigerung verbittert zurecht die grosse säkulare Bevölkerungsmehrheit und die nationalreligiösen Israelis, die im Gegensatz zu den meisten Ultraorthodoxen Militärdienst leisten. Denn sie mussten als Armeeangehörige während der letzten zwei Jahre enorme Opfer erbringen.
Die ultranationalistischen und ultraorthodoxen Parteien besitzen in Israel zwar lediglich ein beschränktes Wählerpotenzial. So kamen die zwei Parteien der beiden rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich bei den letzten Wahlen mit ihrer Listenverbindung auf nicht einmal ganz 11% der Stimmen.
Auch wenn man die übrigen im israelischen Parlament, der Knesset, vertretenen ultrareligiösen und Rechtsaussenparteien dazu nimmt, liegt der gesamte Anteil dieser Wählerschichten nur bei knapp 30% – vergleichbar mit den Rechtspopulisten in zahlreichen europäischen Ländern.
Aber aufgrund der starken Zersplitterung der Knesset können dort Kleinstparteien als Zünglein an der Waage oft einen überproportionalen Einfluss auf die Regierungsbildung und -politik ausüben.
Spätestens in einem Jahr, im Oktober 2026, sollen in Israel Wahlen stattfinden. Dann wird sich zeigen, ob sich der jüdische Staat aus dem Würgegriff dieser rechtsradikalen und ultrareligiösen Gruppierungen befreien kann. Sonst droht ihm die grösste Gefahr nicht von aussen, sondern von sich selbst.
Dieser Bericht erschien auch auf nebelspalter.ch
Sacha Wigdorovits ist Präsident des Vereins Fokus Israel und Nahost, der die Webseite fokusisrael.ch betreibt. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte, Germanistik und Sozialpsychologie und arbeitete unter anderem als USA-Korrespondent für die SonntagsZeitung, war Chefredaktor des BLICK und Mitbegründer der Pendlerzeitung 20minuten.
Haben Sie einen Fehler entdeckt?