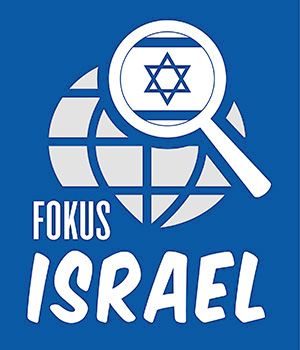7. November 2025
Universitäten als Brutstätten des Glaubens statt Wissens
Von Sacha Wigdorovits
Auf Netflix läuft derzeit eine unterhaltsame Serie mit dem Titel «Nero». Sie handelt von einem professionellen Killer und dessen Tochter, die der letzte noch lebende Nachkomme des Teufels sein soll.
Die Geschichte spielt in Südfrankreich im ausgehenden Mittelalter. Zu den wichtigen Akteuren gehören die «Büsser»: Eine Gruppierung fundamentalistischer und fanatischer Katholiken, die glauben, dass die Abkehr von Gott schuld an der Dürre und Hungersnot in der Gegend ist. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass diese Büssergemeinschaft auf Initiative eines machthungrigen Erzbischofs ins Leben gerufen wurde. Doch am Schluss haben die Büsser auch von ihm genug und werfen ihn deshalb kurzerhand vom Balkon seiner Kathedrale.
Die Serie ist eine Abrechnung mit der katholischen Kirche. Ihr wird vorgeworfen, an den Aberglauben der einfachen Bevölkerung zu appellieren, um mit apokalyptischen Verheissungen und brutaler Gewalt die eigene Macht zu festigen und die eigene Politik durchzusetzen.
Ungewollt ist «Nero» damit auch eine Allegorie auf die heutige Zeit. Wobei an die Stelle der katholischen Kirche die Universitäten getreten sind. Denn dort wird heute oftmals nicht mehr Wissen und nüchternes Denken vermittelt, wie es eigentlich die Aufgabe wäre. Stattdessen werden aus politischen Motiven Glauben und Fanatismus gefördert.
Dies ist vor allem in den geisteswissenschaftlichen Fächern der Fall. Und es findet statt von Boston und New York bis Zürich und Basel und vor allem: Lausanne und Genf.
Am deutlichsten zeigt sich dies im Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza, den Palästinensern und den Juden (pardon: «Zionisten»). Unter dem Banner des Postkolonialismus werden hier geschichtliche und aktuelle Fakten ersetzt durch ein sachlich unfundiertes Glaubensbekenntnis, das sektiererische Züge trägt.
Wie schon bei den Büssergruppierungen, die zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert in vielen europäischen Ländern ihr Unwesen trieben, gilt auch für diese postkolonialen Studenten und manche ihrer naturgemäss links angesiedelten Professoren: Die Juden sind schuld an unserem Elend. Weshalb sie verfolgt und vertrieben werden müssen.
Ebenso wie seinerzeit die katholische Kirche dem Treiben der Büsser lange Zeit zuschaute – oder es sogar förderte –, so schauen auch heute die Universitätsleitungen diesem Treiben ihrer Studenten und gewisser Professoren oft lange Zeit zu oder unterstützen sie aktiv dabei.
Letzteres gilt für die Universitäten in Genf und Lausanne – den beiden grössten akademischen Brutstätten von Antisemitismus in der Schweiz. Dort kappten die Universitätsleitungen die institutionelle Zusammenarbeit mit israelischen Hochschulen. Ob sie dies aus Angst vor dem fanatisierten Studentenmob getan haben oder aus eigener Überzeugung, ist irrelevant.
Auf Englisch heisst das Zeitalter, in dem in Europa Frauen als Hexen verbrannt, angeblich Glaubensabtrünnige gefoltert und Juden verfolgt und umgebracht wurden, «the dark ages – das dunkle Zeitalter». Und es dauerte ein paar hundert Jahre, bis nach dieser finsteren Epoche von Aberglauben und blindem Fanatismus die Zeit der Aufklärung anbrach.
Aber auch dieses «Age of Enlightenment» (Zeitalter der Erleuchtung) war nicht frei von Rückfällen in dunkle Zeiten. Es ist weniger als hundert Jahre her, seit wir in Europa den barbarischen Terror und Fanatismus der Nationalsozialisten und in den USA die politischen «Hexenverbrennungen» der McCarthy-Ära erlebten, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Jetzt sind wir im Begriff, in Europa und in den USA das Rad erneut zurückzudrehen, in eine weitere «dunkle Zeit». Neu ist dabei, dass diesmal nicht die Kirche oder Politik eine zentrale Rolle spielen, sondern jene Institutionen, die mehr als alle anderen Wissen und Humanismus fördern statt (Irr-)Glauben und Fanatismus schüren sollten: die Universitäten.
Glücklicherweise ist dies nicht überall der Fall – oder mindestens nicht überall im gleichen Ausmass. So erklärten beispielsweise die beiden vom Bund getragenen Hochschulen, die ETH in Zürich und EPFL in Lausanne, öffentlich, dass sie die Zusammenarbeit mit israelischen Hochschulen weiter fortsetzen werden. Auch die Universitäten in Bern und Zürich sprachen sich gegen einen Boykott von israelischen Hochschuleinrichtungen oder Forschern aus.
Aber dort, wo die Universitätsleitungen und Professoren dem Druck ihrer antisemitischen und gewaltbereiten Studentenschaft nachgeben – oder diese Gruppierungen sogar aktiv unterstützen –, sollten die Standortkantone diesem Treiben einen Riegel schieben.
Die Mittel dazu haben sie in der Hand. So können die kantonalen Parlamente bei der Subventionierung der Universitäten klare Auflagen bezüglich der Führung der Universität, der Anforderungen an Lehre und Forschung sowie des Verhaltens von Lehrkörper und Studenten machen.
Dazu muss insbesondere gehören, dass akademisches Wissen ohne politische Agenda vermittelt wird (was leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist), und dass politische Aktionen, die nichts mit dem Universitätsbetrieb selbst zu tun haben, auf dem Universitätsgelände verboten sind.
Ausserdem muss klar festgehalten werden, dass Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen ein vertraglich festgelegter Kündigungsgrund für fehlbares Lehrpersonal sind, einen Ausschluss der zuwiderhandelnden Studenten von der betreffenden Hochschule zur Folge haben und bei derselben zu Subventionskürzungen durch den Kanton führen.
Mit einer Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit hat dies nichts zu tun. Denn die antisemitischen Kundgebungen, das Mobbing jüdischer Studierender und jüdischer Professoren und die Proteste gegen die Zusammenarbeit mit israelischen Hochschulen sind nicht Ausdruck liberaler Meinungsäusserung. Sie sind Zeichen einer linksradikalen Meinungsdiktatur, die es zu bekämpfen gilt.
Einerseits, weil sich der Hass und Fanatismus, der dabei zutage tritt, nicht nur gegen die Juden richtet, sondern gegen unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft ganz allgemein.
Andererseits, weil Universitäten keine Daseinsberechtigung haben, wenn sie Brutstätten für Fanatismus und fehlgeleitete politische Glaubensbekenntnisse sind, statt Vermittler und Inkubatoren von Wissen, eigenständigem, rationalen Denken und Ethik.
Dieser Beitrag erschien auch auf nebelspalter.ch
Sacha Wigdorovits ist Präsident des Vereins Fokus Israel und Nahost, der die Webseite fokusisrael.ch betreibt. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte, Germanistik und Sozialpsychologie und arbeitete unter anderem als USA-Korrespondent für die SonntagsZeitung, war Chefredaktor des BLICK und Mitbegründer der Pendlerzeitung 20minuten.
Haben Sie einen Fehler entdeckt?