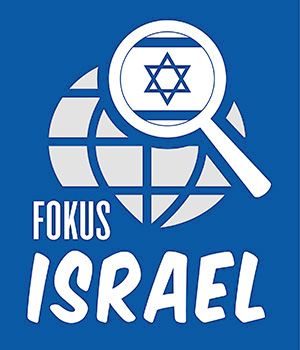8. September 2025
Studie entkräftet Genozid-Vorwürfe gegen Israel
Vorwürfe, Israel begehe im laufenden Krieg in Gaza Völkermord, Kriegsverbrechen oder setze gezielt Massenverhungern ein, sind in einer umfassenden Untersuchung in Frage gestellt – und teils entkräftet – worden.
Die am 3. September 2025 veröffentlichte Studie «Debunking the Genocide Allegations: A Reexamination of the Israel-Hamas War (2023–2025)» stammt vom Begin-Sadat Center for Strategic Studies sowie der Hebräischen Universität Jerusalem. Auf 311 Seiten analysieren die Autoren humanitäre Berichte und Opferstatistiken, untermauert durch quantitative Methoden und forensische Dokumentation. Ziel sei eine faktenbasierte Neubewertung der Genozid-Narrative, betonen sie – nicht jedoch eine rechtliche oder moralische «Reinwaschung».
Die Veröffentlichung erfolgt in einem heiklen Moment: Die IDF bereitet die Operation Gideon’s Chariots II in Gaza-Stadt vor, während die International Association of Genocide Scholars erst zwei Tage vor Publikation der Studie in einer Resolution erklärte, Israels Vorgehen erfülle die juristische Definition von Völkermord.
Mehr Lebensmittel im Krieg als davor
Die wohl kontroverseste Erkenntnis der Studie betrifft die Versorgungslage: Laut den Forschern gelangten während des Krieges mehr Lebensmittel nach Gaza als vor dem 7. Oktober 2023. Die oft zitierte UN-Forderung von 500 Hilfstransporten täglich sei eine «Fehldarstellung», so die Autoren. Vor dem Krieg seien es im Schnitt 73 Lastwagen gewesen (2022). Bis Mitte Januar 2025 lag der Durchschnitt bei 101 (COGAT), UNRWA korrigierte seine Angaben später auf 83.
Trotz ausreichender Mengen hätten Plünderungen durch die Hamas Engpässe erzeugt. Angaben, wonach 44 % von Gazas Nahrung aus lokaler Landwirtschaft stammten, seien unbegründet – realistisch seien maximal 12 %.
Opferzahlen gezielt verfälscht
Die Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza (GMoH) seien manipuliert, da per Anweisung alle Toten als Zivilisten geführt würden. Das verfälsche internationale Berichte. Auffällig sei etwa die Zahl gemeldeter Witwen (13’900), die fast exakt der Übersterblichkeit von Männern im kampffähigen Alter entspreche (13’964). Zudem hätten IDF-Schutz- und Evakuierungszonen wie al-Mawasi signifikant weniger Opfer verzeichnet.
UN- und NGO-Berichte systematisch fehlerhaft
Die Studie dokumentiert «systematische Fehler» internationaler Organisationen: zirkuläre Zitate, intransparente Bewertungen, stillschweigende Korrekturen. Beispiel: UNRWA sprach nach Mai 2024 von einem 70%-Rückgang an Hilfslieferungen, korrigierte diese Daten später – ohne dies öffentlich hervorzuheben. Dennoch werde die falsche Zahl weiter zitiert.
«Humanitärer Bias» als strukturelles Problem
Die Autoren führen ein neues Konzept ein: humanitärer Bias. Damit meinen sie die Neigung, alarmistische Angaben unkritisch zu übernehmen, um rasch Handlungsdruck zu erzeugen. Korrekturen würden dann ignoriert. So habe etwa UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher im Mai 2025 fälschlich behauptet, 14’000 Babys würden binnen 48 Stunden sterben, falls keine Hilfe eintreffe. Zwei Tage später zog die UN diese Aussage zurück.
Keine Belege für systematischen Völkermord
Die Untersuchung entkräftet systematische Völkermord-Absichten, schliesst aber «lokale Fehlverhalten und mögliche Kriegsverbrechen» nicht aus. Die IDF habe aussergewöhnliche Massnahmen wie präzises Targeting, Vorwarnungen und Missionsabbrüche ergriffen, was zivile Opfer reduziert, aber für die Armee selbst kostspielig gewesen sei. Im Vergleich zu anderen westlichen Armeen im Häuserkampf sei das Verhältnis von Kämpfern zu Zivilisten bei der IDF relativ niedrig.
Begriff Genozid droht, an Bedeutungskraft zu verlieren
Die Ergebnisse widersprechen internationalen Einschätzungen, darunter den vorläufigen Massnahmen des Internationalen Gerichtshofs, der Israel verpflichtet, Völkermord zu verhindern. Die Autoren warnen: Würde jeder urbane Krieg als Genozid eingestuft, verliere der Begriff seine rechtliche und moralische Bedeutungskraft.
Die Forscher fordern ein methodisches Umdenken: systematische Quellenprüfung, Transparenz und Resistenz gegenüber politisch-medialen Narrativen. Ziviles Leid sei «tragisch und unbestreitbar», doch müsse humanitärer Diskurs faktenbasiert bleiben, um echte Gräueltaten in Zukunft nicht zu übersehen.
Quelle: Jerusalem Post vom 5. September 2025 (übersetzt aus dem Englischen)
Haben Sie einen Fehler entdeckt?