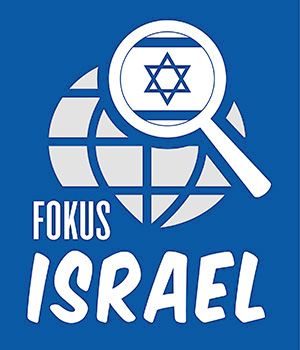22. August 2025
Mit neuen Siedlungen gegen einen Staat «Palästina»
Von Sacha Wigdorovits
Neben der humanitären Situation in Gaza erregt jetzt auch der Siedlungsbau im Westjordanland die Gemüter westlicher Politiker sowie der israelischen Opposition. Dies gilt namentlich für die Ankündigung des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich, in der sogenannten E1-Zone 3’400 weitere Wohneinheiten zu errichten.
«E1» steht für das englische Wort «East» (Ost) und meint ein knapp 12 Quadratkilometer grosses Gebiet, das von Ostjerusalem bis ins rund sieben Kilometer entfernte Ma’ale Adunim reicht, einer im Westjordanland gelegenen, 1977 gegründeten israelischen Siedlung mit 50’000 Bewohnern.
Die Idee, auf dem E1-Gebiet 3’500 neue Wohneinheiten zu bauen, ist nicht neu. Entstanden ist sie aus Sicherheitsüberlegungen, um im Kriegsfall die Verbindung zwischen Jerusalem und Ma’ale Adunim zu gewährleisten.
Der rechtsextreme Minister Smotrich verfolgt damit allerdings hauptsächlich ein ganz anderes Ziel: Er will mit der Besiedlung des E1-Gebiets ein weiteres Hindernis für die Gründung eines eigenständigen palästinensischen Staates schaffen.
Entsprechend harsch reagierte nicht bloss die israelische Opposition auf der linken Seite des Parteienspektrums, sondern geharnischt fielen auch die Reaktionen in gewissen europäischen Hauptstädten aus.
Letzteres entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn es waren der französische Präsident Emanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer, die Smotrich den Steilpass lieferten, jetzt mit der Besiedlung des E1-Gebietes vorwärtszumachen.
Sie hatten nämlich gedroht, Palästina als Staat anzuerkennen, falls Israel in Gaza nicht sofort die Waffen ruhen lasse und einen Waffenstillstand mit der Hamas aushandle. Das war für Smotrich ein willkommener Anlass, der von ihm vehement bekämpften Zweistaaten-Lösung buchstäblich weitere Steine in den Weg zu legen.
Seit dem 7. Oktober 2023 ist das Misstrauen Israels gegenüber den Palästinensern ohnehin sprunghaft angestiegen. Aber auch jede neue israelische Siedlung im Westjordanland schafft vollendete Tatsachen, die eine Umsetzung der Zweistaaten-Lösung verunmöglichen, welche die UNO 1947 beschlossen hatte.
Bis vor wenigen Jahren war dies anders: Die israelischen Siedlungen im Westjordanland waren kein unüberwindbares Hindernis für eine Zweistaaten-Lösung.
Zwischen 1948, als der jüdische Staat gegründet wurde, und 1967, als Israel die arabischen Armeen im Sechs-Tage-Krieg vernichtend schlug, war das Westjordanland vom Königreich Jordanien besetzt – und Gaza von Ägypten.
Die ersten israelischen Siedlungen entstanden im Westjordanland erst ab 1968, und sie hatten einzig strategisch-militärische Gründe: die Grenzen Israels gegenüber zukünftigen Angriffen besser abzusichern.
Eine zweite Welle brachte dann Siedler aus religiös-ideologischen Gründen ins Westjordanland, dem historischen Judäa und Samaria. Sie wollten mit ihren Siedlungen den jüdischen Anspruch auf dieses biblische Gebiet dokumentieren und zementieren.
In den letzten Jahren folgte eine dritte Welle von Siedlern. Diese zogen aus wirtschaftlichen Gründen ins Westjordanland, weil sie dort billiger wohnen können und bei ihrem Umzug von der Regierung finanziell unterstützt werden. Zu diesen Siedlern gehören viele ultra-orthodoxe Juden, die aufgrund ihrer Lebensweise (in der das Torastudium einen grossen Platz einnimmt) finanziell oft nicht gut gestellt sind.
Entsprechend dieser Entwicklung wuchs die Zahl jener Israelis, die im Westjordanland leben, zunächst nur langsam an. Bis 1980 waren es insgesamt weniger als 20’000. Zur Zeit des Oslo-Abkommens zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Itzhak Rabin und PLO-Chef Yasser Arafat im Jahr 1993 waren es rund 120’000.
Als Arafat im Jahr 2000/2001 die von US-Präsident Bill Clinton und dem damaligen israelischen Regierungschef Ehud Barak vorgeschlagene Zweistaaten-Lösung ablehnte, lebten im Westjordanland 200’000 israelische Siedler. Sie beanspruchten rund 3% des gesamten Gebietes des neuzugründenden Staates Palästina. Dieses Gebiet wäre mit israelischem Territorium kompensiert worden. Gewisse israelische Siedlungen wären zudem geräumt worden (so wie es wenige Jahre später, 2005 mit allen Siedlungen in Gaza geschah).
Sieben Jahre später, 2008, als der damalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert den Palästinensern einen Teilungsplan vorschlug, waren es bereits 300’000 Siedler. Doch da der weitaus grösste Teil immer noch in der Nähe der israelischen Staatsgrenze lebte, wäre auch damals dieses Problem mit einem Gebietsabtausch und Siedlungsräumungen zu lösen gewesen – wenn die Palästinenser den Teilungsplan Olmerts nicht abgelehnt hätten.
Heute ist eine solche Lösung kaum mehr denkbar. Inzwischen lebt im Westjordanland über eine halbe Million israelischer Siedler. Nicht mitgerechnet sind dabei jene über 200’000, die in Ostjerusalem wohnen. Dieses hatte Israel 1967 im Sechs-Tage-Krieg wie das Westjordanland von Jordanien erobert und später als eigenes Staatsgebiet annektiert. (Die Palästinenser beanspruchen Ostjerusalem nach wie vor als ihre zukünftige Hauptstadt.)
Für die UNO, den Internationalen Gerichtshof ICJ und eine grosse Zahl von Staaten, darunter die meisten europäischen, gilt das Westjordanland als von Israel zu Unrecht «besetztes» Gebiet, der dortige israelische Siedlungsbau als «illegal».
Israel, die jetzige US-Regierung und auch viele ihrer Vorgänger-Regierungen sowie renommierte, auf solche Fragen spezialisierten Juristen sehen dies anders.
Sie kritisieren unter anderem, dass der Begriff «besetztes Gebiet» für das Westjordanland falsch sei. Denn bis zur Eroberung durch Israel 1967 sei das Westjordanland von Jordanien kontrolliert worden, aber nicht jordanisches Staatsgebiet gewesen. (Die UNO hatte das Gebiet 1947 als Teil eines neuzugründenden arabischen Staates, heute «Palästina» genannt, vorgesehen).
Da es sich somit beim Westjordanland nicht um das Territorium eines fremden Staates handle, könne die dortige Präsenz israelischen Militärs und israelischer Bürger auch nicht als «Besetzung» bezeichnet werden.
Richtig sei es stattdessen, das Westjordanland als «disputed – umstritten» zu bezeichnen. Denn aufgrund der jüdischen geschichtlichen Verbundenheit mit diesem Gebiet könne Israel mit ebenso gutem Recht Anspruch auf das Westjordanland erheben wie die Palästinenser. Zumal dieser Anspruch auch in internationalen Zusicherungen wie der «Balfour-Deklaration» von 1917 und der darauf aufbauenden Resolution von San Remo 1920 bekräftigt worden sei.
Als falsch erachten es diese Kritiker auch, wenn die UNO die israelischen Siedlungen als «illegal» bezeichnet, weil sie gegen die Vierte Genfer Konvention verstossen würden. Diese Konvention verbiete zwar die zwangsweise Umsiedlung der eigenen Bevölkerung auf ein fremdes Staatsgebiet. Aber die Israelis, die sich im Westjordanland niederliessen, täten dies freiwillig und ohne Zwang.
Die Vierte Genfer Konvention könne im Fall der israelischen Siedlungen also nicht angewandt werden. «Illegal» seien lediglich jene Ortschaften im Westjordanland, deren Bau der israelische Oberste Gerichtshof aus den einen oder anderen Gründen verboten habe. Dies ist in der Vergangenheit wiederholt geschehen.
Der frühere Präsident des ICJ, Stephen Schwebel, wies ausserdem darauf hin, dass ein Staat zur Selbstverteidigung fremdes Gebiet besetzen und dort Massnahmen ergreifen dürfe, um die eigene Bevölkerung zu schützen.
Die ersten israelischen Siedlungen im Westjordanland dienten genau diesem Zweck. Und jene Wohneinheiten, die jetzt im E1-Gebiet östlich von Jerusalem gebaut werden sollen, wurden ursprünglich ebenso begründet.
Dass damit die Möglichkeit, einen palästinensischen Staat zu bilden, weiter eingeschränkt beziehungsweise verunmöglicht wird, entspricht durchaus der langfristigen Zielsetzung der jetzigen israelischen Regierung.
Ihrer Ansicht nach kann die Sicherheit Israels nur gewährleistet werden, wenn ein solcher Staat nie entsteht. Seit dem 7. Oktober 2023 dürfte sie mit dieser Überzeugung nicht nur im eigenen Land, sondern auch in den USA und sogar in Europa bei vielen Politikern auf Verständnis stossen. Selbst wenn diese es nicht offen zugeben.
Sacha Wigdorovits ist Präsident des Vereins Fokus Israel und Nahost, der die Webseite fokusisrael.ch betreibt. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte, Germanistik und Sozialpsychologie und arbeitete unter anderem als USA-Korrespondent für die SonntagsZeitung, war Chefredaktor des BLICK und Mitbegründer der Pendlerzeitung 20minuten.
Haben Sie einen Fehler entdeckt?